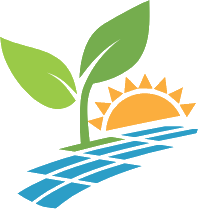Kleinstflexibilitäten als Schlüssel für zukünftiges Netzengpassmanagement
In einer Zeit, in der die Energiewende rasant voranschreitet, stehen die Stromnetze vor neuen Herausforderungen. Der zunehmende Einsatz von Wärmepumpen und die wachsende Elektromobilität verändern die Landschaft des Energieverbrauchs grundlegend. Doch wo Herausforderungen sind, ergeben sich auch Chancen. Eine wegweisende Studie, die von den Energieriesen Amprion, E.ON, TenneT TSO und TransnetBW in Zusammenarbeit mit E-Bridge Consulting durchgeführt wurde, zeigt nun auf, wie diese neuen Verbraucher nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Chance für die Netzstabilität darstellen können.
Einige der Links in diesem Beitrag sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn Sie auf einen Link klicken und den Artikel kaufen oder Ihre Daten angeben (beispielsweise zur Erstellung von unverbindlichen Angeboten), erhalte ich eine Affiliate-Provision, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.
Die Studie: Ein Wegweiser für die Zukunft
Die gemeinsam erarbeitete Studie ist die erste ihrer Art, die einen umfassenden konzeptionellen Rahmen für die Weiterentwicklung des netzübergreifenden Engpassmanagements im Stromnetz der Zukunft vorlegt. Sie adressiert damit eine der drängendsten Fragen der Energiewende: Wie können wir die zunehmende Dezentralisierung und Flexibilisierung des Energiesystems nutzen, um Netzengpässe effizient zu managen?

Kernpunkte der Studie:
- Netzübergreifende Zusammenarbeit: Ein zentraler Aspekt der Studie ist die Erkenntnis, dass Netzbetreiber über alle Spannungsebenen hinweg kooperieren müssen, um Engpässe in einem zunehmend durch dezentrale Flexibilitäten geprägten Netz effizient zu managen.
- Marktbasierter Redispatch für Kleinstflexibilitäten: Als zentrales Lösungsmodell wird der marktbasierte Redispatch für Kleinstflexibilitäten vorgeschlagen. Dieses Konzept ermöglicht es flexiblen Lasten, freiwillig und auf Basis von Geboten Redispatch-Leistungen bereitzustellen. Es stellt eine wichtige Ergänzung zum bestehenden kostenbasierten Redispatch dar.
- Standardisierte Datenaustauschprozesse: Um den marktbasierten Redispatch zu ermöglichen, wurden Datenaustauschprozesse und notwendige Schnittstellen zwischen Netzbetreibern und Flexibilitätsanbietern definiert. Diese Standards gewährleisten eine effiziente Übertragung relevanter Informationen.
- Das Hüllkurven-Konzept: Ein innovativer Ansatz zur Integration von Niederspannungsflexibilitäten ist das sogenannte Hüllkurven-Konzept. Es ermöglicht die Nutzung von Flexibilitätspotentialen aus dem Niederspannungsnetz auf höheren Netzebenen, ohne dabei die lokalen Netzkapazitäten zu überlasten.
- Abgestimmte Abrufprozesse: Die Studie legt großen Wert auf die Entwicklung abgestimmter Abrufprozesse für Flexibilitätspotentiale. Diese Prozesse sind entscheidend, um im Bedarfsfall schnell und zuverlässig reagieren zu können und somit die Netzstabilität zu gewährleisten.
Der Weg zur praktischen Umsetzung
Die Studie geht über theoretische Betrachtungen hinaus und zeigt erprobungsreife Lösungsoptionen für das Engpassmanagement sowohl im Übertragungs- als auch im Verteilnetz auf. Eine der Kernempfehlungen ist der Start einer baldigen Pilotierungsphase. Diese Phase soll dazu dienen, die Vorteile und die praktische Umsetzbarkeit des komplementären marktbasierten Redispatch unter realen Bedingungen zu testen.
Der vorgeschlagene Ansatz sieht ein schrittweises Pilotieren auf freiwilliger Basis vor. Dies soll sicherstellen, dass die großen und bisher ungenutzten Potentiale rechtzeitig in das Engpassmanagement eingebunden werden. Die Autoren der Studie betonen jedoch, dass für eine erfolgreiche Umsetzung auch Anpassungen am regulatorischen Rahmen notwendig sein werden.

Das enorme Potenzial von Kleinstflexibilitäten
Die Bedeutung dieser Studie wird durch Zahlen der Bundesnetzagentur unterstrichen. In ihrem Bericht zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit weist die Behörde auf erhebliche Flexibilitätspotenziale hin:
- Wärmepumpen: Bis 2031 wird ein Potenzial von 56,6 GW für Verbrauchsanpassungen erwartet.
- Solare Heimspeicher: Ein Potenzial von 10,4 GW wird prognostiziert.
- E-Mobilität: Hier wird sogar ein Potenzial von 42,3 GW erwartet.
Zusätzlich zu diesen Zahlen gibt es weitere Potenziale bei Wärmepumpen und Anlagen der Klima- und Kältetechnik. Diese Flexibilitäten, die bisher im bestehenden regulatorischen Rahmen noch nicht erschlossen werden, gilt es nun für das Engpassmanagement nutzbar zu machen.
Ausblick und Bedeutung
Die vorgestellte Studie markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem flexiblen und stabilen Stromnetz der Zukunft. Sie zeigt nicht nur die technischen Möglichkeiten auf, sondern gibt auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung.
Die Integration von Kleinstflexibilitäten in das Netzengpassmanagement birgt enorme Chancen:
- Erhöhte Netzstabilität: Durch die Nutzung flexibler Lasten kann das Netz besser auf Schwankungen reagieren.
- Effizientere Nutzung erneuerbarer Energien: Flexibilitäten können helfen, Überproduktion und Unterversorgung auszugleichen.
- Kostenersparnis: Ein effizienteres Netzmanagement kann langfristig Kosten für den Netzausbau reduzieren.
- Partizipation der Verbraucher: Durch den marktbasierten Ansatz können Verbraucher aktiv am Energiemarkt teilnehmen und von ihrer Flexibilität profitieren.
Die Umsetzung der in der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, Energieversorgern, Technologieanbietern und Regulierungsbehörden erfordern. Die empfohlene Pilotphase wird dabei helfen, praktische Erfahrungen zu sammeln und mögliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu adressieren.
Insgesamt zeigt die Studie einen vielversprechenden Weg auf, wie die Herausforderungen der Energiewende in Chancen umgewandelt werden können. Die Integration von Kleinstflexibilitäten in das Netzengpassmanagement könnte sich als Schlüssel für ein stabiles, effizientes und nachhaltiges Stromnetz der Zukunft erweisen.